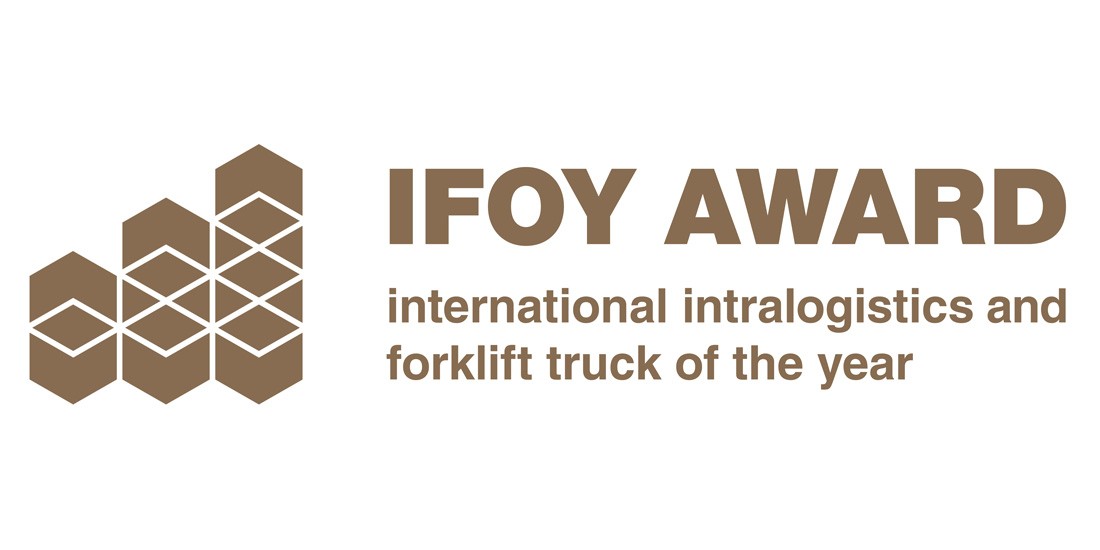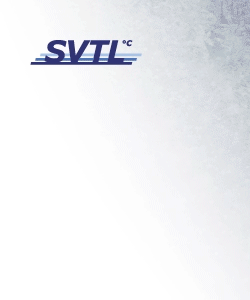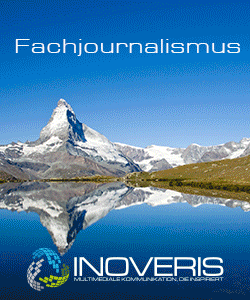Ein grosses Danke an alle unsere Partner die uns Unterstützen und mit uns in die Zukunft gehen.
Messen & Events
Staplerhersteller und Logistik Dienstleister




Intralogistik



WAGNER Schweiz AG - WAGNER Group - WAGNER Group
Schweizer Verbände
Information's- und Medienpartner
LI Webdesigne
- Details
- Geschrieben von: Martin Schmid